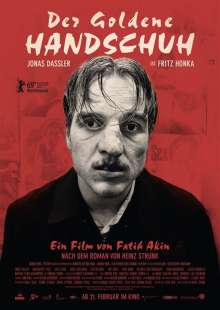In jüngeren Jahren wäre mein Standpunkt gegenüber
Melancholie der Engel eindeutiger gewesen. Obwohl ich mich selbst als aufgeschlossenen Filmliebhaber sehe und damals schon sah, hätte dieser kleine Underground-Film alle konservativen Sinne gereizt, um in einer Besprechung mit dem Holzhammer auf diesen einzuhämmern. Mangels größerem Interesse bisher immer übergangen, wagte ich mich für meine Rundgänge durch den deutschen Genrefilm an den selbsternannten kontroversen Film. Abstreiten möchte ich ihm diese Bezeichnung nicht ganz. Obwohl ich mich zur Zeit seiner Veröffentlichung noch in einschlägigen Horror-Foren rumtrieb, ignorierte ich Threads darüber weitgehend und hakte ihn schnell als nicht meine Interessen ansprechendes Amateur-Filmchen ab, während ein Freund Aufgrund seiner angeblich krassen Bilderfluten in Schwärmereien ausbrach.
Sein Regisseur Marian Dora, ein Schüler Ulli Lommels, watet in seinem Werk zusammen mit Co-Autor und Hauptdarsteller Carsten Frank - der hier das Pseudonym Oliver Frank nutzt - durch menschliches und filmisches extrem und verzichtet weitgehend auf eine schlüssige Handlung. Den Rahmen bildet eine Begegnung der zwei Männer Katze und Brauth, alte Freunde, die über einen Jahrmarkt streifen und die beiden jungen Frauen Melanie und Bianca kennenlernen. Nach deren anfänglicher Ablehnung den beiden Fremden gegenüber, gelingt es den alten Freunden, die Frauen in einen Nachtclub einzuladen um von dort in Begleitung von Anja, welche sich dort der Gruppe anschließt, zu einer alten Hütte, mit der Brauth und Katze Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit verbinden, zu locken. Mit der Ankunft des geheimnisvollen Heinrich und seiner im Rollstuhl sitzenden Begleitung Clarissa gleiten die von Drogen und philosophischen Exkursen dominierten Abende in eine mehrere Tage andauernden, hemmungslosen wie gewalttätigen Orgie ab.
Etwas mehr als zweieinhalb Stunden nimmt Dora den Zuschauer mit auf eine schonungslose Reise menschlicher Verderbtheit. Ohne jemals die Motivation der Figuren zu erfahren,
wieso die Figuren zu solchen Taten schreiten, bricht nach einem ruhigen, einlullenden Aufbau ein ewig langer Exzess zwischen ausufernder Gewalt und sexueller Extremen über den Zuschauer herein. Die
menschliche Verderbtheit und die düstersten Seiten unserer Existenz ziehen sich ebenso durch Doras Filme wie sein thematischer Fokus auf die Sterblichkeit des menschlichen Individuums. Nachdem der Fall um den "Kannibalen von Rotenburg" Achim Meiwes landesweit die Medien bestimmte, wurden zwei diesen Fall behandelnden Filme produziert. Nachdem der durch eine Klage Meiwes' ewig im Giftschrank gehaltenen
Rohtenburg nahm sich Dora dem ganzen mit seinem
Cannibal an und lieferte einen durchaus sehenswerten Beitrag ab, der seine exploitative Seite hinter einer nicht uninteressanten, pseudo-anspruchsvollen Fassade verstecken konnte.
Dieses Konzept weiten Dora und Frank in
Melancholie der Engel aus; ihre düsteren und verstörenden Visionen versteckt das Duo hinter weichgezeichneten Einstellungen. Das verwendete Material und seine Bearbeitung schenkt dem Film eine dunkle, getrübte Stimmung, welche die schonungslos zur Schau getragene Behandlung des
Verfalls der menschlichen Körperlichkeit passend untermalt. Dora scheint besessen, getrieben von dieser Thematik zu sein, die sich bis in sein jüngstes Werk
Carcinoma - einer Art düsterem wie krassen Krebs-Splatter-Drama -zieht. Neben der unumgänglichen Sterblichkeit, auf die wir Menschen zusteuern, bedient sich
Melancholie der Engel einer rigorosen Darstellung des seelischen und moralischen Verfalls. Dieser Interpretationsansatz des Films und die Deutung seiner (männlichen) Figuren als verschiedene Verkörperungen menschlicher Eigenschaften wird von diesem selbst erstickt. Seine kryptische Chiffre lässt sich einzig von den Schöpfern entschlüsseln. Der - wenn überhaupt vorhandene - tiefere Sinn der gezeigten Flut an Gewalt, sexueller Ausschweifung und Körperausscheidungen bzw. -flüssigkeiten, beschränkt auf einen engen Raum, dessen Ausstaffierung mit für das Horror-Genre üblicher Symbolik des Verfalls überhäuft wurde, bleibt verborgen.
Die pseudo-tiefgründige Erscheinung von
Melancholie der Engel raubt ihm die Glaubhaftigkeit, sich mit den angekratzten Themen ernsthaft auseinandersetzen zu wollen. Freunde von Tabubrüchen am laufenden Band dürften dafür ihre helle Freude haben, wenn Dora z. B. in langen Einstellungen künstliche Darmausgänge brutal fingern lässt oder sich die Darsteller ihre Körper gegenseitig mit ihren Ausscheidungen schmücken. Hinzu kommt, dass der Film u. a. durch die an den jungen Frauen ausgeübten Taten nicht ganz frei von misogynen und behindertenfeindlichen Tönen ist, was den Film leider wie eine Umsetzung von in Dora und Frank schlummernder Gewaltfantasien erscheinen lässt. Trauriger Höhepunkt ist die Animal Cruelty, die eine höhere Dichte aufweisen lässt, als mancher italienischer Kannibalenfilm. Zwar beteuerten die Macher, das alles gestellt ist, was man Anhand der Bilder nur schwer bis gar nicht glauben mag. Das traurige ist, dass die beiden dies nicht einmal nötig hätten. Vielleicht möchte man krasser wie die Filme Buttgereits wirken, oder dem amerikanischen
Körperflüssigkeiten-Splatters aus dem tiefsten Untergrund nacheifern. Dahingehende Einflüsse sind spürbar, nur bettet man die plumpen Provokationen in ein künstlerisches Bett ohne Substanz. Das angestrebte
Slaughtered Vomit Arthouse entpuppt sich als langgezogener Bullshit ohne erkennbaren, tieferen Sinn.
Die Leere hinter der Fassade von
Melancholie der Engel lässt die mit der voranschreitenden Laufzeit gezeigten, krasser werdenden Extreme offensichtlich belanglos erscheinen und den Zuschauer fast unbeeindruckt zurück. Weniger verkopfte, um die Ecke philosophierte Symbolik und - soweit das überhaupt möglich ist - sinnvoll eingestreute Exzessivität hätten den Film zu einer Art filmischer
Neuer Deutscher Todeskunst formen können, wenn überhaupt jemals die Absicht besteht bzw. bestand, sich ernsthaft innerhalb des Films mit dem steten Verfall von Körper sowie Geist auseinanderzusetzen. Nur sein visueller Stil und der stimmige Soundtrack, der sich auch bei fremden Kompositionen von Gerhard Heinz und dem Schauspieler David Hess (
Last House On The Left) bedient, fallen gänzlich positiv auf. Der Rest schreitet bei allen unter der dicken Schicht Dreck und Verfall aufblitzenden, guten Ansätzen auf den tiefen Abgrund der Belanglosigkeit zu. Wäre da nicht die Tatsache, dass mir der Film auch einige Tage nachdem ich in gesehen hatte, im Kopf nachhallte. Leider nicht, weil sein Umgang mit der von Dora und seinem Co-Autoren aufgegriffenen Thematik tief beeindruckte, sondern weil er einen lange ratlos zurücklässt,
was denn nun überhaupt der Sinn des Ganzen ist. Wäre früher daraus zu 99 Prozent ein gnadenloser Verriss geworden, zuckt man mittlerweile ratlos die Schultern, was dieser
Arthouse-Splatter bar jeden wahren Verstands überhaupt soll.