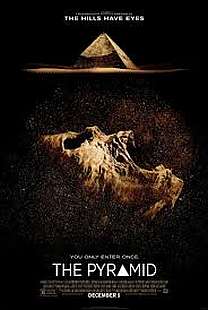Das Happy End eines Horrorfilms bedeutet für seine Protagonisten nicht immer den vermeintlich versöhnlichen Schluss nach der psychischen und physischen Tortur, der sie ausgesetzt waren. Das Drehbuchautoren ein Hintertürchen für eine etwaige Fortsetzung offen lassen und in den letzten Einstellungen die Wiederauferstehung der vermeintlich besiegt geglaubten Vertretung des Bösen auf Erden zelebrieren, hat sich über die Jahrzehnte fest als Standard etabliert. Im Slasher leben ganze Reihen von dieser Mechanik und ließen Freddy, Michael, Jason und Co. im Dauertakt ihr Comeback feiern. Auch Mad Doctor of Blood Island (hier besprochen) deutet in seiner letzten Szene an, dass das grünblütige Chlorophyll-Monster, welches darin über titelgebendes Bluteiland wandelte und mordete, das Finale wohl überlebt hat.
Zwei Jahre sollten in die Lande ziehen, bis Eddie Romero erneut sein Bündel packte und, diesmal ohne seinen Kollegen Gerardo de Leon, zum dritten und letzten Male Richtung Blood Island schipperte. Als Hauptdarsteller stand wieder John Ashley vor der Kamera und seinem Regisseur treu zur Seite. Abermals verkörpert Ashley den Doktor Bill Foster, der sich am Ende von Mad Doctor of Blood Island auf ein Schiff retten konnte. Beast of Blood knüpft direkt an diesen an und konfrontiert Foster mit dem einen sehr lebendigen Eindruck machenden Monstrum, dass sich in einem Rettungsboot des Kahns versteckt hat und nun Radau schlägt. Im Kampf mit dem Ungetüm fängt das Schiff Feuer und versinkt im Meer. Foster kann sich retten und tritt nach dem Vorspann eine erneute Reise nach Blood Island an. Manchmal kommen sie schon wieder.
An seine Fersen haftet sich die Reporterin Myra Russell, die von den Vorfällen auf Blood Island Wind bekommen hat und eine große Story wittert. Dort angekommen, scheint alles wie immer. Stammesführer Ramu nimmt den Besuch gastfreundlich auf und beklagt sich gleichzeitig über vermisste Angehörige. Grund dafür ist, dass neben dem Chlorophyll-Wüstling auch Dr. Lorca überlebt hat und seine Experimente unbehelligt weiterführt. Als der Wissenschaftler Myra in seine Gewalt bringt, bläst Foster Alarm und versucht mit Hilfe der Einwohner die Journalistin aus dessen Fängen zu befreien. Im Vergleich mit seinen beiden Vorgängerfilmen entwickelt sich Beast of Blood zu einem seichten Abenteuer-Film mit leichten Horror-Einschüben. Für diese neuen Impulse sorgte Beverly Miller, ein Kinobesitzer, der unbedingt bei einem Filmprojekt involviert sein wollte und die Story verfasste, als Co-Produzent fungierte und im Film eine kleine Rolle als Schiffskapitän bekleidete.
Das aktionsbetontere Werk, dass ihm dabei vorschwebte, ist Beast of Blood nur bedingt. Der Weg zu unterhaltsamen Momenten ist auf Blood Island steinig und unwegsam und so vergeudet der Film seine Laufzeit häufiger mit wenig relevantem Füllwerk. Foster verliert sein Herz schnell an seine journalistische Begleiterin und wird von Ramus Enkelin Laida bezirzt, was ein kommender Anlass für erotische Momente ist. Bis der Film gänzlich aus den Puschen kommt, wird viel im Dschungel umher gewandert und geredet. Atmosphärisch macht das einen runderen Eindruck als bei Mad Doctor of Blood Island, der schwerfällige Erzählstil bleibt auch im dritten Film bestehen. Der einlullende Hauch von Exotik besitzt im Nachgang eine trübe Note. Spaß stellt sich spät ein und kann planlosere Momente in der Regie und Storygestaltung nicht kaschieren.
Als einziger der Blood Island-Filme schaffte es Beast of Blood unter dem Titel Drakapa, das Monster mit der Krallenhand in die deutschen Kinos und man kann erahnen, warum nur er es war, von dem sich hiesige Verleiher Potenzial beim Geld einbringen versprachen. Beast of Blood fällt gemäßigter aus, ist weniger krude und bietet geringere Obskuritäten, die ein deutsches Publikum eventuell abgeschreckt und ferngehalten hätte. Der amerikanische Einfluss sticht deutlicher hervor und zeigt in seinen Actionszenen ansatzweise das, was die Philippinen in Co-Produktion mit amerikanischen Studios in den 70ern noch in die Kinos bringen sollten. Wenn auch nicht überzeugender, so war er gefälliger für das damalige westliche Publikum. Das macht ihm zum schwächsten Teil der Blood Island-Filme, der seine Momente besitzt, von denen es gesamt zu wenig gibt, um gleichauf mit dem kruden Unterhaltung von Brides of Blood und Mad Doctor of Blood Island zu sein.
Zwei Jahre sollten in die Lande ziehen, bis Eddie Romero erneut sein Bündel packte und, diesmal ohne seinen Kollegen Gerardo de Leon, zum dritten und letzten Male Richtung Blood Island schipperte. Als Hauptdarsteller stand wieder John Ashley vor der Kamera und seinem Regisseur treu zur Seite. Abermals verkörpert Ashley den Doktor Bill Foster, der sich am Ende von Mad Doctor of Blood Island auf ein Schiff retten konnte. Beast of Blood knüpft direkt an diesen an und konfrontiert Foster mit dem einen sehr lebendigen Eindruck machenden Monstrum, dass sich in einem Rettungsboot des Kahns versteckt hat und nun Radau schlägt. Im Kampf mit dem Ungetüm fängt das Schiff Feuer und versinkt im Meer. Foster kann sich retten und tritt nach dem Vorspann eine erneute Reise nach Blood Island an. Manchmal kommen sie schon wieder.
An seine Fersen haftet sich die Reporterin Myra Russell, die von den Vorfällen auf Blood Island Wind bekommen hat und eine große Story wittert. Dort angekommen, scheint alles wie immer. Stammesführer Ramu nimmt den Besuch gastfreundlich auf und beklagt sich gleichzeitig über vermisste Angehörige. Grund dafür ist, dass neben dem Chlorophyll-Wüstling auch Dr. Lorca überlebt hat und seine Experimente unbehelligt weiterführt. Als der Wissenschaftler Myra in seine Gewalt bringt, bläst Foster Alarm und versucht mit Hilfe der Einwohner die Journalistin aus dessen Fängen zu befreien. Im Vergleich mit seinen beiden Vorgängerfilmen entwickelt sich Beast of Blood zu einem seichten Abenteuer-Film mit leichten Horror-Einschüben. Für diese neuen Impulse sorgte Beverly Miller, ein Kinobesitzer, der unbedingt bei einem Filmprojekt involviert sein wollte und die Story verfasste, als Co-Produzent fungierte und im Film eine kleine Rolle als Schiffskapitän bekleidete.
Das aktionsbetontere Werk, dass ihm dabei vorschwebte, ist Beast of Blood nur bedingt. Der Weg zu unterhaltsamen Momenten ist auf Blood Island steinig und unwegsam und so vergeudet der Film seine Laufzeit häufiger mit wenig relevantem Füllwerk. Foster verliert sein Herz schnell an seine journalistische Begleiterin und wird von Ramus Enkelin Laida bezirzt, was ein kommender Anlass für erotische Momente ist. Bis der Film gänzlich aus den Puschen kommt, wird viel im Dschungel umher gewandert und geredet. Atmosphärisch macht das einen runderen Eindruck als bei Mad Doctor of Blood Island, der schwerfällige Erzählstil bleibt auch im dritten Film bestehen. Der einlullende Hauch von Exotik besitzt im Nachgang eine trübe Note. Spaß stellt sich spät ein und kann planlosere Momente in der Regie und Storygestaltung nicht kaschieren.
Als einziger der Blood Island-Filme schaffte es Beast of Blood unter dem Titel Drakapa, das Monster mit der Krallenhand in die deutschen Kinos und man kann erahnen, warum nur er es war, von dem sich hiesige Verleiher Potenzial beim Geld einbringen versprachen. Beast of Blood fällt gemäßigter aus, ist weniger krude und bietet geringere Obskuritäten, die ein deutsches Publikum eventuell abgeschreckt und ferngehalten hätte. Der amerikanische Einfluss sticht deutlicher hervor und zeigt in seinen Actionszenen ansatzweise das, was die Philippinen in Co-Produktion mit amerikanischen Studios in den 70ern noch in die Kinos bringen sollten. Wenn auch nicht überzeugender, so war er gefälliger für das damalige westliche Publikum. Das macht ihm zum schwächsten Teil der Blood Island-Filme, der seine Momente besitzt, von denen es gesamt zu wenig gibt, um gleichauf mit dem kruden Unterhaltung von Brides of Blood und Mad Doctor of Blood Island zu sein.